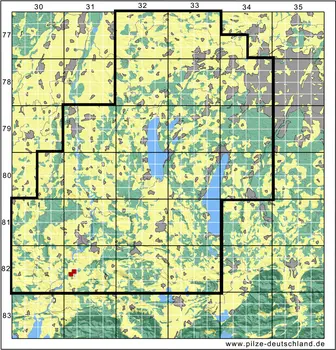Omphaliaster asterosporus (J.E. Lange) Lamoure
Synonyme: Hygroaster asterosporus (J.E. Lange) Singer
Systematik: Basidiomycota > Agaricales > Tricholomataceae
Deutscher Name:
Vorkommen:
In sauren Nadelwäldern (Fichten- oder Kiefernwälder), auf morschen Nadelholzstubben, aber auch bodenbesiedelnd, dann gerne auf armen Sandböden zwischen Flechten und Moosen. Zerstreut, wohl wenig beachtet.
Vorkommen am Ammersee:
Selten, bislang nur im Süden bei Peiting/Deutensee nachgewiesen.
In unserer Datenbank gibt es 2 Fundmeldungen.
Makroskopische Bestimmungsmerkmale:
Hut jung konvex, bald abgeflacht mit niedergedrückter Hutmitte, graubraun bis grau-ockerbraun mit dunkelbrauner Hutmitte, feucht glänzend, trocken eher matt, bis 2 cm im Durchmesser, bis zur Hälfte des Radius deutlich gerieft.
Lamellen leicht herablaufend, blass ockerlich grau, entfernt stehend, etwas dicklich.
Stiel bis 60 x 3 mm, zylindrisch, hutfarben, glatt.
Geruch und Geschmack mehlig.
Sporenpulver weiß.
Mikroskopische Bestimmungsmerkmale:
Sporen subglobos bis globos, 5-7,5 x 4,5-6,5 µm, morgensternartig stachelig ornamentiert.
Basidien keulig, 30-40 x 8-10 µm, viersporig, ohne Basalschnalle.
Zystiden fehlend.
Schnallen fehlend.
Bemerkungen:
Makroskopisch kommt zunächst die Sammelgattung Omphalina in Frage (oder ein omphalinoider Rötling, Entoloma). Im Mikroskop ist die Art aber durch die deutlich morgensternartig ornamentierten Sporen sofort der Gattung Omphaliaster (=Hygroaster) zuzuordnen. Ähnlich, aber deutlich größer, ist Omphaliaster borealis. Diese Art unterscheidet sich durch die viel größeren Fruchtkörper (Hut bis 5 cm im Durchmesser), den dunkleren Hut sowie die etwas kleineren Sporen (5-6 x 4,5-5,5 µm) und das arktisch/alpine Verbreitungsareal (gerne in Sphagnum).
Autor: Dr. Christoph Hahn
Quelle / Literatur:
Kasparek F. (1999): Starkgeriefter Sternsporling Omphaliaster asterosporus. Der Tintling 17(5/1999), Portrait Nr. 19 (ohne Seitenzahl, vordere Umschlagseiten).
Knudsen H., Vesterholt J., Hrsg. (2008): Funga Nordica.